Im Mai 2006 hält die renommierte deutsche Katastrophensoziologin und Warnexpertin Elke Geenen auf der 55. Jahrestagung der mittlerweile aufgelösten Schutzkommission beim Bundesminister des Innern einen Vortrag über strukturelle Probleme des deutschen Warnwesens. Im Gegensatz zum meist technologieorientierten Blick auf Themen im Bevölkerungsschutz ist ihre Perspektive gesellschaftswissenschaftlicher Natur. Sie skizziert viele Grenzen, die Warneffektivität zum damaligen Zeitpunkt behindern: keine Einbindung der Kommunen ins Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS), komplexe Abstimmungsherausforderungen zwischen Zuständigkeitsbereichen und Organisationen, Warnlücken wie mangelnder Einbezug von bestimmten sozialen Gruppen, fehlende Forschung zur Effektivität von Warntexten und Bevölkerungsverhalten.
Heute, fast 14 Jahre später und inmitten einer Krise, die eine Dauerwarnlage auf Bund-, Länder- und Kommunalebene hervorgerufen hat, stehen wir an einem Punkt, an dem sich das Warnwesen in Deutschland qualitativ und quantitativ stark verändert hat. Welche von Geenens 2006 benannten Barrieren wurden mittlerweile überwunden? Und welche existieren weiterhin?
Was ist Warnung?
Die technologische Struktur des deutschen Warnsystems hat sich verändert, damit einhergehend aber auch die gesellschaftlichen Erwartungen. Das Verständnis von amtlichen Warnungen der Bevölkerung hat sich international in den vergangenen Jahrzehnten fundamental gewandelt, aus verschiedenen Gründen: die Veränderung der demografischen Struktur – unsere Gesellschaft ist kulturell noch vielfältiger, aber auch älter geworden - sowie ein hoher Informations- und Mitgestaltungsbedarf parallel zur rasanten Entwicklung neuer Informationstechnologien. Hinzu kommt der stärkere Einfluss gesellschaftswissenschaftlicher Perspektiven und damit die Erkenntnis, dass eine Warnung nicht einem simplen Sender-Empfänger-Schema folgt.
Elke Geenen formuliert es 2009 so: „Eine Warnung ist nur dann eine Botschaft an die Betroffenen, wenn sie die Rezipienten nicht nur im physischen Sinne erreicht, sondern sie auch anspricht. Insofern ist jede Botschaft, auch eine Alarmierung oder Warnung, eine Interaktion zwischen zwei Seiten.“
Warnungen in Krisen- und Katastrophenlagen haben das Ziel, die Betroffenen mit Informationen zu unterstützen - damit sie informierte Entscheidungen treffen können, was aus Sicht der Gefahrenabwehrbehörden heißt: empfohlene Maßnahmen zum eigenen Schutz, zum Schutz anderer Personen und Lebewesen oder zum Schutz von materiellen Gütern und des Lebensraums zu ergreifen. Das Ziel von Warnungen ist es, die Auswirkungen einer Gefahr so gering wie möglich zu halten und in letzter Konsequenz Leben und Unversehrtheit zu schützen. Das Warnen, das Gewarnt-Sein bzw. das Gewarnt-werden-Können trägt somit entscheidend dazu bei, Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen zu stärken. Eine Warnung ist effektiv, wenn sie genau das leistet: wenn die Betroffenen die amtlichen Informationen der Warnung tatsächlich als Unterstützung nutzen (können). Dann ist sie ein zentraler Bestandteil der Gefahrenabwehr, der Krisenkommunikation und des Krisenmanagements.
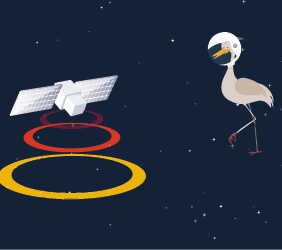
Verwaltungsgrenzen
In unserer hochkomplexen Gesellschaft ist das eine hochkomplexe Aufgabe, sowohl technisch als auch gesellschaftlich. Es gibt, wie Elke Geenen 2006 darlegt, viele Grenzen, an denen eine Warnung ihre Effektivität verlieren, an der sie sogar partiell scheitern kann. Einige der wesentlichen Aspekte, die Geenen 2006 formuliert, sind mittlerweile erfüllt. So ist die strukturelle Lücke des Warnwesens in Bezug auf die kommunale Ebene durch den Ausbau des Modularen Warnsystems des Bundes (MoWaS) seit 2013 weitgehend geschlossen. Für die Warnung der Bevölkerung waren im Dezember 2020 insgesamt 345 MoWaS-Stationen und -Zugänge auf Länder-, Stadt- und Kreisebene in Betrieb.
Dies war ein zwingender Schritt, denn letztendlich sind es die Kommunen und Gemeinden, die die größte Nähe zu möglichen Betroffenen haben. Es ist ein großer Fortschritt, dass nicht-polizeiliche und zunehmend auch polizeiliche Gefahrenabwehr, dass Bund, Länder und viele Kommunen sich ein und desselben Warnkanalssystems bedienen. Aus Sicht der potenziell zu Warnenden ist es bedarfsgerecht, sich nicht durch einen Dschungel verschiedener Apps schlagen zu müssen. Aus Sicht der MoWas-Bediener eröffnet es zusätzlich die Möglichkeit eines satellitengestützten, sicheren Kommunikationsweges über MoWaS im Falle eines Ausfalls der Telekommunikationsleitungen.
Dass eine Technologie von sehr vielen unterschiedlichen Akteuren bedient wird, die möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen von Warnbedarfen, Warnschwellen und Warntexten haben, ist jedoch auch eine Herausforderung. Indem man durch die Einbindung der kommunalen Ebene viele Grenzen überwunden hatte, taten sich neue wieder auf, nämlich die zwischen verschiedenen Zuständigkeitsbereichen: Stadt- und Kreisgrenzen, Ländergrenzen und Organisationsgrenzen. Die Autonomie der Zuständigkeitsbereiche und Fragmentierung der Durchführung von Warnung kann dadurch zu Abstimmungsproblemen führen, zur mangelnden Übermittlung von Informationen in der übergreifenden Zusammenarbeit und damit zu Warnlücken.
Die Vermeidung von Widersprüchen ist jedoch ein zentraler Aspekt der Warneffektivität. Wenn sie widerspruchsfrei über verschiedene Kanäle oder in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen herausgegeben werden, verstärken sich Warnungen gegenseitig. Widersprüchliche Warnungen dagegen verzögern die Reaktionen in der Regel. Es findet dann ein verstärktes sogenanntes Information Milling statt, also das Suchen nach weiteren Informationen. Maßnahmen zum Selbstschutz werden dann häufig erst mit Verzögerung ergriffen.
Das bloße Ausbleiben einer Warnung, während im angrenzenden Bereich gewarnt oder informiert wird, kann ein Widerspruch sein. Eine kommunikative Herausforderung kann auch sein, wenn verschiedene Organisationen an einer Lage beteiligt sind, z. B. Polizei und Feuerwehr, die in ihrer jeweiligen Zuständigkeit Informationen zur Lage herausgeben. Wenn diese Informationen entweder widersprüchlich sind oder auch nur widersprüchlich scheinen, führt es in der Regel dazu, dass Betroffene weitere Informationen suchen, anstatt Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das gleiche gilt z. B. für aktualisierte Warnungen, in denen die Veränderungen zu älteren Warnungen nicht kenntlich gemacht werden.
Die Gefahr ist bekannt. Es gibt eine Vielzahl von Überlegungen, diesem strukturellen Problem zu begegnen. Dennoch ist es eine große Herausforderung, bei der effektiven Standardisierung von Abstimmungsabläufen über Stadt- oder Organisationsgrenzen hinweg mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Notwendig ist hier die Entwicklung abgestimmter, möglichst einheitlicher Warnkonzepte. Gute Infomanagement- und Krisenkommunikationskonzepte können gewährleisten, solche Widersprüche zu vermeiden. Ein Beispiel dafür sind die Städte Mannheim (Baden-Württemberg) und Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz).
Im Rahmen des EU-geförderten ISF Bund-Länder-Projekts Warnung der Bevölkerung, das im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe koordiniert wird, entwickeln die beiden Städte ein abgestimmtes Warnkonzept über Stadt- und Ländergrenze hinweg. Dies umfasst sowohl Strategien, wie die „Leitlinien für ein Gemeinsames Warnkonzept von Bund und Ländern“ (2019) kommunalen Gegebenheiten angepasst werden können, z. B. für eine die Warnung vorbereitende Risikokommunikation. Untersucht werden auch Möglichkeiten der Ablaufoptimierungen des Warnprozesses selbst. Nur durch den Rhein voneinander getrennt, in einer Region mit hohem Risikopotenzial – die Rhein-Neckar-Region ist Sitz des größten europäischen Chemie-Clusters, u. a. auch der BASF -, arbeiten die beiden Städte im Einsatzgeschehen bereits eng zusammen. Auch in warnrelevanten Lagen tauscht man sich aus. Wie dies durch systematische planungsrationale Strukturen noch robuster gestaltet werden könnte, wird zurzeit evaluiert.
Verständnisgrenzen
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Kanälen, mit steigender Tendenz, über die Warnungen herausgegeben werden. Seit der Einführung von Warn-Apps können Behörden dabei auch längere Texte direkt auf die Smartphones der Nutzer senden. Die Erwartungen und Bedarfe von Betroffenen, aber auch die Bedarfe der Mitarbeitenden warnender Behörden an Weiterbildung und unterstützenden Strukturen haben sich dadurch verändert. Die eingangs erwähnten Forschungsbedarfe wurden zum Zeitpunkt der App-Einführung 2015 noch drängender. Wie gestaltet man z. B. Warntexte, mit denen man möglichst viele, im besten Fall aber alle Anspruchsgruppen anspricht? Wie überwindet man Akzeptanz-, Verständnis- und Sprachgrenzen?
Zwingend für die bessere Wahrnehmung von Warnungen war bei dieser Aufgabe die Mehrsprachigkeit, die Anfang 2019 im Modularen Warnsystem implementiert wurde. Seitdem stehen je nach Gefahr vordefinierte Textbausteine in Englisch, Spanisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch und Russisch zur Verfügung. Die systemeigene Warn-App NINA des BBK kann diese Textbausteine seit November 2020 anzeigen. Zusätzlich sind hier App-Texte wie z. B. Notfalltipps und FAQs auch in Leichter Sprache abrufbar. Eine Ad-hoc-Übersetzung der möglicherweise detaillierteren deutschen Warntexte ist zurzeit noch nicht möglich: Eine automatisierte Übersetzung ist bislang (noch) nicht verlässlich. Hier muss man auf weitere technologische Entwicklungen warten. Dennoch werden durch die mehrsprachige Darstellung der Warnungen und anderer Texte in der Warn-App NINA nun Sprach- und Kulturgrenzen überwunden. Das war ein wichtiger Schritt hin zu einem gesamtgesellschaftlich funktionierenden Warnwesen. Nun muss die Effektivität behördlicher Warnungen und Informationen bei nicht-deutschen Muttersprachlern greifbarer und messbarer werden. Es bieten sich hier Beteiligungsformate an, bei denen Akzeptanz, Angebot, Barrieren und Bedarfe abgeglichen werden können.
Verständnisgrenzen existieren jedoch nicht nur bei nicht-deutschen Muttersprachlern. Auch das sprachliche Niveau der deutschen Bevölkerung variiert stark, z. B. die Fähigkeit, abstrakt formulierte Botschaften zu verstehen. Untersuchungen darüber, wie Warnungen effektiv formuliert werden können, sind also ebenso zwingend, und ein erster Schritt ist hier auch mittlerweile getan. Das vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sowie vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geförderte Ressortforschungsprojekt „Betrachtung einiger sozialwissenschaftlicher Aspekte der Warnung der Bevölkerung“ (SAWaB), durchgeführt von den Universitäten Greifswald und Jena, wurde im April 2020 abgeschlossen. Eine Publikation des Abschlussberichts ist in Arbeit. Hier wird wissenschaftlich fundiert beschrieben, was die Effektivität eines Warntextes steigert und was sie mindert. Eine Warnung ist dabei umso effektiver, je mehr sie wahrgenommen und akzeptiert wird und je häufiger Betroffene die Handlungsempfehlungen zum Selbstschutz umsetzen.
Wissensgrenzen
Viel hat sich also getan seit 2006. Der Anspruch, konsistente Warnungen über Grenzen aller Art hinweg herausgeben zu können, wird mehr und mehr erfüllt. Einige Barrieren gilt es jedoch noch zu überwinden: Die Wissenslücken im Hinblick auf ein evidenzbasiertes Bevölkerungsverhalten in Krisen und Katastrophen sind groß; Vorurteile, Stereotype und Alltagstheorien sind weit verbreitet. Die Selektivität journalistischer Berichterstattung verstärkt dies, aus dramaturgischen Gründen fokussiert man sich hier auf „Plünderungen“ oder „Panik“. Wie Geenen in ihrem Vortrag 2006 ausführte, ist dabei der aufsehenerregendste Befund der willkommenste, „auch wenn er in der Regel jeglicher Grundlage entbehrt und zudem stets unklar bleibt, warum es zu diesen irrationalen Verhaltensweisen kommen soll“. Die sozialwissenschaftliche internationale Forschung weist hier seit Jahrzehnten andere und sehr viel differenzierte Ergebnisse auf.
Hier muss Abhilfe geschaffen werden, denn nur mit evidenzbasiertem Wissen zu Reaktionen, Selbsthilfepotenzialen und Bedarfen werden die benötigten Informationen in der Warnung herausgegeben. Forschung zum Bevölkerungsverhalten wird umfangreich international betrieben, vor allem in den USA, ein von vielen Katastrophen unterschiedlichster Art heimgesuchtes Land. US-amerikanische Ergebnisse sind allerdings nicht vollständig übertragbar. Im Januar 2021 startete im BBK deshalb ein interdisziplinäres Projekt zum „Lagebild Bevölkerungsverhalten für ein effektives staatliches Krisenmanagement“. Aufgabe ist es, deutsche und internationale Forschungsergebnisse in die operativen Prozesse des Krisenmanagements einzubringen, und somit auch in Krisenkommunikation und Warnprozesse.
Die Warnung der Bevölkerung ist als Gegenstand der Bundes- und Landesgesetzgebungen gesetzlicher Auftrag. Effektiv zu warnen ist dabei eine interdisziplinäre und ebenenübergreifende Aufgabe. Neue Technologien, gesellschaftliche Perspektiven, eine bessere Datenlage und validierte Maßnahmenempfehlungen unterstützen die Verantwortlichen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Und die wird auch in den nächsten Jahren sicher nicht kleiner.
Die Literatur liegt bei der Redaktion.
Crisis Prevention 1/2021
Nathalie Schopp
Referat I.3 - Psychosoziales Krisenmanagement Abteilung I - Krisenmanagement
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Provinzialstraße 93, 53127 Bonn
Tel: +49 228 99 550-2271
E-Mail: Nathalie.Schopp@bbk.bund.de
Dr. Jutta Helmerichs
Referat I.3 - Psychosoziales Krisenmanagemen
Abteilung I - Krisenmanagemen
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Provinzialstraße 93, 53127 Bonn
Tel: +49 228 99 550-2400
E-Mail:Jutta.Helmerichs@bbk.bund.de













